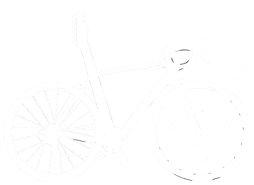Hochmut kommt vor dem Sturz
Heulen bringt nichts
Einerseits hat die teilweise Überschneidung der Tour de France 2018 und der Fußball-WM gezeigt, dass Radfahrer auf der Memmen-Skala weit unter den Fußballern rangieren. Besonders deutlich wurde das durch den Vergleich zwischen Lawson Craddock und Neymar. Zum einen ist es wahrscheinlich bequemer sich minutenlang auf dem Rasen zu wälzen als auf dem Asphalt, zum anderen hast Du die Tour verloren, wenn Du so viel Zeit wie Neymar mit schmerzverzerrtem Gesicht über Dein Schicksal lamentierend auf dem Boden verbringst.
Schon doof: Stürze gehören zum Rennrad fahren
Andererseits zeigen Fälle wie Craddock oder Philippe Gilbert, dass Stürze bei Radfahrern so etwas wie ein Berufsrisiko sind. Und man kann davon ausgehen, dass die Jungs, die bei den großen Profirennen an den Start gehen, ihr Arbeitsgerät überdurchschnittlich gut beherrschen. Nun geht es bei Ausfahrten von Hobbyfahrern nicht so eng und hektisch zu wie im Profi-Peloton vor einer Sprintankunft, trotzdem fährt man für das Tempo doch relativ nah beieinander, so dass es schon mal zu Körperkontakt kommt. Und am Ende des Feldes muss man sich auch im Hobbysport blind auf seinen Vordermann verlassen können, weil man nicht wirklich sieht, was weiter vorne auf der Straße passiert.
Alles unter Kontrolle?

So ist es unerlässlich, dass sich jeder auf seinem Rad wohl und sicher fühlt und immer alles unter Kontrolle hat. Aus diesem Grund lädt Trainer Peter Zaun an diesem Sonntag zum Fahrsicherheitstraining, auch Kuscheltraining genannt. Der Name impliziert, dass es in einem Fahrerfeld durchaus zum Körperkontakt kommen kann. Sei es aus Versehen, sei es dass man in eine Lücke fahren will, die sich als zu schmal entpuppt oder sei es, dass man mal eben den Arm auf die Schulter des Nebenmannes legt, um sich besser nach hinten umschauen zu können. Fahrsicherheit und Radbeherrschung sind Voraussetzung, unvorhersehbare Situationen ohne Panik bewältigen zu können.
Das Dumme an unvorhersehbaren Situationen

Apropos unvorhergesehene Situationen. Das Dumme an ihnen ist, dass auch eigentlich vorhersehbare Situationen, die man aus vermeintlichen Banalitätsgründen verdrängt, dazu gehören. Wie ich schmerzlich erfahren muss. Aus Gründen der Kontrolle, damit man im Notfall schneller den Fuß auf den Boden bekommt, sollen wir normales Schuhwerk tragen. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Vor allem bin ich es nicht mehr gewohnt, dass ich mit dem Fuß vorne über das Pedal rutschen könnte. Im Grunde eine eigentlich vorhersehbare Situation, die ich aus diversen Gründen wohl ignoriere. Banalität? Hybris? Was auch immer, jedenfalls rutsche und ich ungefähr zur Mitte des Trainings mit dem rechten Fuß nach vorn weg, während ich gerade leicht nach links lenke. Und so ein Turnschuh ist eine verdammt effektive Art der aus der Mode gekommenen Stempelbremse, sie bringt das Vorderrad in Nullkommanix zum Stillstand. Es folgt eine ziemliche schmerzhafte Art von Purzelbaum. Stürze sind immer ärgerlich, am meisten die vermeidbaren, am allermeisten die vermeidbaren Selbstverschuldeten. Neben dem Schmerz kommt die Erkenntnis: Fahrsicherheitstraining? Brauch ich wohl. Der Sturz war an der Stelle nicht mehr zu verhindern, das vorherige Wegrutschen sicherlich schon.
Radfahren: Es geht immer besser

Das Beispiel zeigt: Radbeherrschung, Koordination etc. kommt nicht von selbst. Man muss es genauso trainieren wie zum Beispiel Grundlagenausdauer. Ich bringe hier immer gerne den Satz, der mir vor Augen führt, was meinen Beruf als Journalist und mein Hobby Radfahren verbindet: Was haben Schreiben und Radbeherrschung gemeinsam? Du kannst beides nie gut genug. Nikolaus Blome liegt manchmal daneben und Peter Sagan auf der Straße. Selten – aber es passiert.
Und so werden die Dinge auf einem Supermarktparkplatz in Köln-Weidenpesch erst einmal auf den Kopf gestellt. Es gibt ein Rennen über rund 30 Meter, wobei der letzte gewinnt. Man muss also so langsam wie möglich fahren, seitwärts, zickzack, hin und her ist verboten. Stehen bleiben darf man, allerdings müssen die Füße auf den Pedalen bleiben.
Physikalische Gesetze oder auch: Ein Sack Reis in China
Diese simple Übung verdeutlicht vieles, worum es beim Radfahren geht: Je schneller das Rad unterwegs ist, desto stabiler fühlt es sich an (gut, ab einem gewissen Tempo dreht sich das wieder um, aber in diesen Bereichen sind wir noch nicht unterwegs). Das hat irgendwas mit Schwung, Trägheit und Masse, also Physik zu tun, mehr kann ich dazu nicht sagen.

Ich habe nämlich nicht Geisteswissenschaften studiert, weil ich super über Physik Bescheid wusste oder es mich so wahnsinnig interessierte. Es reicht mir seit je her, zu wissen, dass physikalische Gesetze existieren und funktionieren. Warum sie so funktionieren, das weiß der Sack Reis in China. Und wenn er das für sich behält, wird sich meine Lebensqualität nicht verschlechtern.
Der Sack Reis in China sorgt also dafür, dass sich ganz langsam fahren nicht gut anfühlt, es ist wie ein Tanz auf rohen Eiern, es ist schwer das Gleichgewicht zu halten, und das trainiert man beim langsam fahren. Dazu gibt es Tricks, wie sich das etwas angenehmer gestalten lässt. Für diese Tricks zeichnet sich wiederum der Sack Reis in China verantwortlich (sprich: sie existieren, sie funktionieren, aber warum, weiß ich nicht so supergenau). Einen dicken Gang benutzen und gegen die dosierte Kraft der (Vorderrad-) Bremse treten. Im Stehen fahren hilft auch. Das hat möglicherweise etwas mit dem Schwerpunkt zu tun. Entscheidend jedenfalls ist, dass jeder das Gefühl hat, das Rad bei höherem Tempo besser unter Kontrolle zu haben, ausreichend unter Kontrolle hat man es allerdings nur, wenn man es bei ganz langsamen Tempo gut kontrollieren kann.
Bremsspuren legen verliert mit den Jahren an Attraktivität

Für den nächsten Schritt zu mehr Sicherheit und Kontrolle ist es unverzichtbar, das Rad auch beim Bremsen unter Kontrolle zu haben. Als ich ungefähr sechs Jahre alt war, bin ich im Sommer unheimlich gerne die leicht abschüssige Straße neben meinem Elternhaus runter gefahren. Es war eine Sackgasse, die unten in eine andere Straße einmündete. Kurz vor dieser Einmündung hab ich dann volles Brett den Rücktritt benutzt, das Rad blockiert und eine möglichst lange Bremsspur auf den Asphalt tätowiert. Meine Eltern fanden das gar nicht gut. Warum, habe ich aber erst verstanden, als sie mich den Reifen irgendwann selber bezahlen ließen. Abgesehen von der destruktiven Wirkung auf den Reifen – egal ob nun mit Rücktritt, Felgen- oder Scheibenbremse – hat das ganze noch eine andere Nebenwirkung. Eine Vollbremsung mit blockiertem Hinterrad bedeutet, auch den vollen Kontrollverlust über das Rad. Das hätte ich schmerzlich gelernt, wenn mir auf der Straße mal ein Auto in die Quere gekommen wäre, zum Glück war da wenig Verkehr. Lenken mit blockierten Rädern – so sagt der Sack Reis – geht in die Hose. Vervollständigt wird die Sinnlosigkeit dieses (ohne Frage enorm großartigen) kindlichen Spaßes durch die Länge der Bremsspur. Die konnte ganz schon lang werden, und diese Länge sagt dem vernunftanfälligen Radfahrer: Ziemliches ineffektives Bremsmanöver: Volle Bremsleistung auf dem Hinterrad, Räder blockiert, erst nach ein paar Metern zum Stehen gekommen und Reifen im Arsch.
Vorne bremsen ist gar nicht so dumm

Dabei haben doch die "Erwachsenen" immer gesagt, die Hinterradbremse ist die wichtigere Bremse. Vor allem: Wenn man vorne bremst, überschlägt man sich. Aber hatten sie Recht? Nein, hatten sie nicht. Das wahre Wunderwerk der Technik ist die Vorderradbremse, sie ist nur nicht ganz so benutzerfreundlich wie die Hinterradbremse (oder der gute, alte Rücktritt), sie ist etwas sensibler als das brachiale "Hintereisen", sie braucht etwas Gefühl, spricht dann aber auch unvermittelt an. Der Sack Reis weiß: Wenn man schnell fährt, treibt einen die Masse nach vorne, bremst man nun das Rad ab, will die Masse weiter nach vorne. Dabei ist egal, ob man vorne oder hinten bremst. Die Masse – das Körpergewicht – verlagert sich auf das Vorderrad und treibt dieses weiter an. Die größere Wirkung entfaltet in dem Moment natürlich die vordere Bremse. Klar ist aber auch, dass die "Erwachsenen" recht behalten, wenn man die Vorderradbremse voll oder zu hart zieht.
Mit dem Wissen, dass das Gewicht nach vorne treibt, sollte man es nach hinten verlagern, und zwar flach auf dem Sattel, damit der Schwerpunkt niedrig bleibt und einen nicht über den Lenker absteigen lässt. Das sind sehr viele kleine Details für eine einfache Bremsung, sie gehen aber sehr schnell ins Unterbewusstsein über. Die Übung, zu beschleunigen, um dann möglichst schnell ohne blockierende Räder zum Stehen zu kommen, beweist das: alle meistern sie gut.
Immerhin: Mehr Craddock als Neymar

Weiter geht es zu einem kleinen Slalom-Parcours. Der Sinn und Zweck dieser Aufgabe: Kleine Richtungsänderungen ohne große Lenkbewegungen. Ein Skifahrer hat bekanntlich keine Lenkvorrichtung zur Verfügung. Er lenkt größtenteils über die Hüfte. Das funktioniert auch beim Radfahren. Eine kleine Gewichtsverlagerung wirkt Wunder. Einfach etwas weiter voraus schauen, wohin und wo lang man fahren will. Die Hüfte und somit das Rad folgen den Augen. Man merkt das, wenn man sich beim fahren nach hinten umschaut, es ist sehr schwer, die Linie zu halten.
Im Grunde macht mir die Übung keine Probleme, nur bei der letzten Fahrt durch den Parcours passiert mir oben beschriebenes Missgeschick. Immerhin bin ich mehr Craddock als Neymar, und stehe nach wenigen Sekunden wieder und freue mich gewaltig über den Schlag in meinem Vorderrad. Wenigstens rollt es noch bei geöffneter Bremse. Ich sitz auch schnell wieder auf dem Rad, doch ich gebe zu, ich bin nölig, der Tag ist für mich gelaufen. Ich mag es nicht mit einer Acht im Vorderrad rumzufahren. Trotzdem mach ich weit mit, ich kann ja nicht hier besserwisserische, heroische und lang ausschweifende Blogs schreiben und dann sagen: Nö, ich mag nicht mehr.
Fahrsicherheitstraining: Fortsetzung folgt

Es geht noch ein bisschen ans Kurven fahren und um das Gefühl, Kontrolle über sein Rad an den Nebenmann abgibt, indem man ihm die eine Hand auf die Schulter legt und die andere auf den Oberlenker, die Bremse außer Reichweite. Du beginnst automatisch, mehr mit dem Körper zu arbeiten und stellst fest: Ist gar nicht so schlimm, und Du lernst, Dich auf den Nebenmann zu verlassen – wichtig für das Fahren in der Gruppe.
Alles in allem, ein lehrreiches Kuscheltraining. Noch immer nach all den Jahren ein Mehrwert. Du bist nie gut genug, und wenn Du glaubst, Du wärst nah dran, dann tritt einfach mal saftig in Dein Vorderrad, Stürzen lehrt Demut – insofern freue ich mich auf Teil zwei des Kuscheltrainings, hoffentlich sturzfrei.
Das Technische Wunderwerk der WochE